Der Biastoch-Bericht
Ein Bericht von Paul Biastoch aus Großtuchen
Haddamar (Hessen) Weihnachten 1946
Der Bericht wurde Weihnachten 1946 bzw. am 1. März 1947 verfaßt.
Das Original liegt handschriftlich in deutscher Schrift vor. Kopie bei:
Frau Margot Fromm Heinestraße 3 52445 Titz 1 Tel.: 02463/5965
Übertragung in die lateinische Schrift und redaktionelle Bearbeitung:
Karl H. Radde Dresden
Die Russen kommen - die Polen verwalten - Flucht über die Oder - am
Ziel!
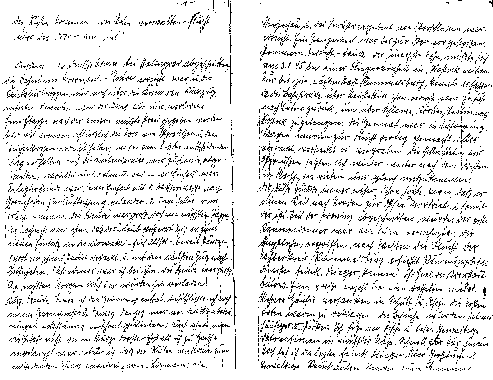 Seitdem die 6. deutsche Armee bei Stalingrad abgeschnitten, die
Bahnlinie Woronesch - Rostow erreicht war, und die Kaukasustruppen nur
noch über die Krim den Rückzug antreten konnten, war der Krieg für uns
verloren. Eine Etappe nach der anderen mußte preisgegeben werden, bis
die russischen Armeen schließlich die Tore von Ostpreußen und den
Weichselbogen erreicht hatten; wo sie zum letzten entscheidenden Schlag
ausholten. Auch die Kurlandarmee war zu Lande abgeschnitten; woselbst
unser Helmut bei einer Einheit war. In letzter Stunde war seine Einheit
auf dem Wasserwege nach Gotenhafen zur Auffrischung gelandet. 2 Tage
sollte er in Urlaub kommen. Die Freude war groß. Doch am nächsten Tage
die Nachricht von ihm, daß der Urlaub gesperrt sei und sie zum neuen
Einsatz in die Slowakei - Ziel Altfol - bereit ständen. Sofort ein
schönes Paket gepackt und mit dem nächsten Zug nach Gotenhafen. 5 Uhr
abends war ich bei ihm. Die Freude war groß. Am nächsten Morgen früh 5
Uhr wurden sie verladen. Kurze Freude. Bevor ich den Heimweg antrat,
besichtigte ich noch meine Garnisonstadt Danzig. Danzig war von den
Bombardierungen vollständig verschont geblieben; auch ahnte man die
Gefahr nicht, die in Kürze drohte. Erst als ich zu Hause angelangt war,
erfuhr ich, daß die Russen wiederum zum entscheidenden Schlag angesetzt
hatten. Litzmannstadt, Tschenstochau und das Industriegebiet von
Oberschlesien war erreicht. Ein Panzerkeil war bis zur Oder
vorgestoßen. Pommern bedroht.
Seitdem die 6. deutsche Armee bei Stalingrad abgeschnitten, die
Bahnlinie Woronesch - Rostow erreicht war, und die Kaukasustruppen nur
noch über die Krim den Rückzug antreten konnten, war der Krieg für uns
verloren. Eine Etappe nach der anderen mußte preisgegeben werden, bis
die russischen Armeen schließlich die Tore von Ostpreußen und den
Weichselbogen erreicht hatten; wo sie zum letzten entscheidenden Schlag
ausholten. Auch die Kurlandarmee war zu Lande abgeschnitten; woselbst
unser Helmut bei einer Einheit war. In letzter Stunde war seine Einheit
auf dem Wasserwege nach Gotenhafen zur Auffrischung gelandet. 2 Tage
sollte er in Urlaub kommen. Die Freude war groß. Doch am nächsten Tage
die Nachricht von ihm, daß der Urlaub gesperrt sei und sie zum neuen
Einsatz in die Slowakei - Ziel Altfol - bereit ständen. Sofort ein
schönes Paket gepackt und mit dem nächsten Zug nach Gotenhafen. 5 Uhr
abends war ich bei ihm. Die Freude war groß. Am nächsten Morgen früh 5
Uhr wurden sie verladen. Kurze Freude. Bevor ich den Heimweg antrat,
besichtigte ich noch meine Garnisonstadt Danzig. Danzig war von den
Bombardierungen vollständig verschont geblieben; auch ahnte man die
Gefahr nicht, die in Kürze drohte. Erst als ich zu Hause angelangt war,
erfuhr ich, daß die Russen wiederum zum entscheidenden Schlag angesetzt
hatten. Litzmannstadt, Tschenstochau und das Industriegebiet von
Oberschlesien war erreicht. Ein Panzerkeil war bis zur Oder
vorgestoßen. Pommern bedroht.
Heinz, der jüngste Sohn, mußte sich am 3. 2. 45 bei einer
Fliegereinheit in Rostock melden. Nur bis zur nächsten Stadt
Rummelsburg konnte er fahren, da die Bahnstrecke über Neustettin schon
bedroht war. Er fuhr nach Bütow zurück, um über Schlawe, Köslin,
Stettin nach Rostock zu gelangen. Die Heimat war in Aufregung. Wagen
wurden zur Flucht fertig gemacht. Alles verpackt, versteckt oder
vergraben. Die Geflüchteten aus Ostpreußen setzten sich wieder weiter
nach dem Westen in Marsch. Sie rieten uns, gleich mitzukommen. Der
Russe rückte immer näher. Schon hörte man, daß er einen Keil nach
Norden zur Ostsee vortrieb und somit der östliche Teil der Provinz
abgeschnitten wurde. Der erste Kanonendonner war von Süden vernehmbar.
Die Ängstlichen ergriffen nach Westen die Flucht. Der Nachbarkreis
Rummelsburg erhielt Räumungsbefehl. Die ersten feindlichen Flieger
kamen. Ihr Ziel die Kreisstadt Bütow. Eine große Anzahl Bomben
rasselten nieder. Mehrere Häuser versanken in Schutt und Asche. Die
ersten Toten waren zu beklagen. Die Besuche wurden immer häufiger und
stärker.
Ich sitze am Tische und lese. Gewaltige Detonationen in nächster
Nähe. Schnell zur Tür hinaus. Noch seh ich die letzten feindlichen
Flieger über Großtuchen. Gewaltige Rauchsäulen stiegen zum Himmel.
Mehrere Gehöfte brannten. Großtuchen erhielt Räumungsbefehl am 3. 3. 45
bis 21 Uhr. Ich wohnte etwa 4 km abseits des Ortes. Kurz entschloß ich
mich, nicht zu flüchten. Schnell setzte ich mich mit den nächsten
Angehörigen, Familie Kramp und Kowalke in Verbindung, die in Großtuchen
wohnten. Auch sie faßten den schweren Entschluß, nicht zu flüchten,
weil unser östliches Pommern schon vom Reich abgeschnitten, daher die
Flucht zwecklos war.
Doch es kam anders. Unsere anrückenden Truppen rieten zur Flucht.
Ein großes Durcheinander. Abends um 6 Uhr waren sie mit dem großen
Flüchtlingsstrom nach Norden geflüchtet. Bis 7 Uhr abends wartete ich
vergebens. Da entschloß ich mich, ihnen mit meinem Ostarbeiter
entgegenzugehen. Doch zu meiner Enttäuschung. Ihr Wagen war schon fort.
Nur die Schwester von Kramp war mit ihrem Mann, wegen seinem Holzbein,
zurückgeblieben.
Noch am Fluchttage starb mein Schwiegervater. Kurz faßte ich den
Entschluß, ihn auch ohne Sarg nach dem Friedhof Großtuchen zu bringen,
um dann die zurückgebliebene Familie Holz mit notdürftigem Gut heim zu
nehmen. Um 24 Uhr nachts in Großtuchen mit der Leiche ohne Sarg im
Leiterwagen vor der ersten Großtuchener Brücke angelangt, wurde ich arg
enttäuscht. Pioniere waren bei der Sprengungsvorbereitung der Brücke
tätig. Ich durfte nur auf eigene Gefahr hinüber. Bei der 2. Brücke
dasselbe Wagnis. Doch ich kam glücklich hinüber. Auf einem Gehöft
machte ich Halt. Mein Ostarbeiter und der des Nachbarn waren mir
behilflich, die Leiche im Laken über die Friedhofsmauer auf den
Friedhof zu bringen. Zwischen 2 anderen Gräbern wurde er mit wenig Erde
bedeckt, so daß noch die Füße zu sehen waren. Wir hatten es eilig, um
wieder zurück über die Brücke zu gelangen, denn sobald die letzten
deutschen Truppen über die Brücke waren, sollte sie in die Luft gehen.
Das Begräbnis war gesang- und klanglos geglückt. Nun galt es, die
zurückgebliebene Familie Holz mitzunehmen. Die Straßen waren von
zurückflutenden deutschen Fahrzeugen aller Art versperrt; doch wir
erreichten seinen kleinen Hof; woselbst wir seine Habseligkeiten
aufluden und dann durch die bewachten Straßen losfuhren. Vor der
Mühlenbrücke machte ich halt. Ich erblickte von weitem einen großen
Haufen auf der Brücke; schon wieder eine Mine. Wir fuhren zur
Hauptstraße zurück, bis wir durch mehrere Hindernisse glücklich auf
unserem Hof ankamen. Alles wieder abgepackt; Rauchware genug.
Am frühen Morgen kam mein Nachbar Kautz mit seiner Familie und
seinen Habseligkeiten auf den Hof zu fahren. Noch warteten wir auf die
Ankunft des Nachbarn Malottki. Da kam die Tochter von Malottkis mit der
Nachricht, daß bei ihr die SS gekommen sei und sie zur Flucht
aufforderten; anderenfalls sie erschossen würden. Schnell eilte ich zu
Malottki. Er stellte den Wagen zur Flucht aus. Gegen Abend fuhr er in
Richtung meines Hofes los. Im Wald ließ er den Wagen stehen und brachte
die Pferde in meine Scheune. Der Feind war jetzt nicht mehr weit. Die
ersten Granaten pfiffen über unser Gehöft. Maschinen- und Gewehrfeuer
waren deutlich zu hören. In Feindrichtung loderte das Feuer der
Nachbarhöfe zum nächtlichen Himmel empor.
Die ersten deutschen Soldaten näherten sich dem Gehöft. Ein
Ritterkreuzträger richtete bei uns seinen Infanteriegefechtsstand auf.
2 Kompanien bezogen auf dem Gehöft Quartier. Kurz gegessen und in
Abwehrstellung gegangen. Mitternacht plötzlicher Befehl zum Abrücken.
Nun standen wir ohne Schutz da. Am nächsten Tage wurde bis abends noch
Widerstand geleistet. Flieger kreisten den ganzen Tag um uns. Es wurde
um unseren Verkehrsknotenpunkt Großtuchen erbittert gekämpft. 3 Panzer
und 2 Flieger wurden abgeschossen. In einem etwa 200 m seitlich
gelegenem Unterstand hatten die Familienangehörigen Schutz gesucht.
Malottki, Kautz und ich blieben auf dem Gehöft zur Beobachtung. Pferde
wurden geschirrt, Ketten der Kühe auf leichtlöslich gestellt. Ebenso
die Schweinebuchten usw. Gegen Abend kamen die ängstlichen Gemüter auf
den Hof, um im Keller Schutz zu suchen. Das Gewehr-, Pakfeuer usw.
näherte sich immer mehr dem Gehöft. Es schien, als seien sie nur wenige
100 m von uns entfernt.
Mein Ostarbeiter (Weißrusse) stand ständig bei der Tür, um sich als
Russe kenntlich zu machen, damit das Feuer eingestellt werden sollte.
Wir hatten wegen seiner guten Behandlung die Gewißheit, daß er uns mit
seiner Frau in Schutz nehmen würde.
Doch plötzlich gegen 22 Uhr abends verstummte das Feuer. Wir
aufgeregten und ängstlichen Gemüter gingen dann in unsere Zimmer und
warteten der Dinge, die da kommen würden. Der Russe kam diesen Abend
nicht mehr. Am nächsten Tage gegen Mittag kam der erste Wagen mit 3
Russen und einem Ostarbeiter als Dolmetscher auf den Hof mit lautem
"Hohré, 3 mal". In jeder Hand einen Revolver vor sich haltend, dazu
sein Koppel mit Handgranaten bestückt. Mit hoch gehobenen Händen gingen
wir ihnen entgegen. Die erste Frage, ob Pollak oder Niemzi. Den
Hausflur betretend, feuerte er den ersten Schuß in die Decke. Dann
betraten sie das Zimmer. Erste Forderung: Uhr, Ringe, Tabak, Wino,
Wudka usw. Alles wurde bereitwillig hingegeben. Alles durchstöbert.
Unsere Ostarbeiterin ausgefragt über ihre Behandlung. Doch sie gab ein
gutes Zeugnis über uns aus, und so rückten sie dann bald ab.
Am nächsten Morgen mußten sich unsere Ostarbeiter bei der
russischen Kommandantur melden. Ihre Abreise war anbefohlen. Sie hatten
sich ein Fuhrwerk zur Abreise vom Nachbar mitgebracht. Schnell wurden
ihre Sachen aufgeladen; dazu von uns Lebensmittel, Kleidung, Betten
usw. Auch eines unserer Pferde ging mit. Alles ging in Eile, denn es
waren wieder Russen mitgekommen. Mit weinenden Augen haben wir uns
verabschiedet. Wassil winkte: "Ich besuch euch wieder", und ab fuhren
sie. Nun standen wir ohne Schutz dar. Ein Russe nahm unser bestes Pferd
unter Sattel und ritt zu unserem Nachbarn Jantz. Von dort sollte ich
das Pferd wieder zurück nehmen. Doch es kam anders. Beim Nachbarn
angelangt, ritt er weiter. 4 Russen stöberten dort alles durch. Auch
ich wurde gründlich auf Waffen untersucht und mit vorgehaltener
Maschinenpistole gestoßen und auf Parteizugehörigkeit ausgefragt, bis
sie mich schließlich wieder losließen, um weiter in den Zimmern alles
durchzustöbern. Ich glaubte schon, meine letzte Stunde hätte
geschlagen. In einem Zimmer erblickte ich den Bruder meines Nachbarn
und Kolberg. Ich fragte sie: "Wo ist Nachbar Jantz?" Er sagte: "Er hat
sich mit seiner Frau im Fluß ins Wasser gestürzt und sie sind tot".
Darauf kam ein Russe in unser Zimmer. In einer Hand eine
Jagdpatronenhülse. Zeigte sie dem Bruder des ertrunkenen Jantz. Holt
aus und wirft eine Flasche an seinen Kopf. Doch er wich aus, und die
Flasche flog durchs Fenster. Der Russe ging weiter. Jantz sagte: "Die
schießen mich heute tot." In einem unbemerkten Augenblick verschwand
ich durch die Küche; schnell über den Berg feldeinwärts. Etwa 150-200 m
entfernt eröffneten sie mit der Maschinenpistole das Feuer auf mich. In
tiefem Schnee raffte ich die ganze Kraft zusammen, um schnell weiter zu
kommen. Sie folgten im Laufschritt und schossen immer wieder, bis ich
schließlich im Wald ihren Blicken entschwinden konnte. In eiligem Tempo
ging ich aus voller Brust keuchend immer weiter bis andere Russen, ein
Stab, 3 Offiziere und 1 Bursche, mich wieder erblickten. Auf mich
zureitend, ging ich mit hochgehobenen Händen entgegen. Ich mußte
mitgehen. Der Bursche blieb zurück, während die Offiziere im Trabe
weiterritten. Wieder kam uns eine russische Kolonne entgegen. Nach
allem ausgefragt, wobei ich mein Alter von 58 Jahren auf Schnee
schrieb, ließen sie mich laufen. Tieferschöpft ging ich nach unserem
Unterstand, wo ich ein wenig ausruhte und meinem Schöpfer von Herzen
dankte, daß er mich vor dem sicheren Tode bewahrt hatte.
Nun ging ich langsam durch die Waldschonung meinem Gehöft zu. Unweit
erblickte ich wieder einige Russen mit einer Frau, die in Richtung auf
den Unterstand gingen. Ich wartete ein Weilchen. Schon sah ich, daß sie
hinter mir her waren und auch nach dem Hof steuerten, ohne mich jedoch
zu bemerken. Im schnellsten Laufschritt eilte ich auf mein Gehöft (es
waren nicht 100 m) und ich war in letzter Sekunde unbemerkt auf dem
Heuboden verschwunden. Sonst wäre ich diesmal dem sicheren Tod geweiht
gewesen. Die Frau hatte sich die Russen mitgebracht, damit sie mich
erschießen sollten. Auf dem Gehöft war ich nicht zu finden. Meine Frau
wurde aufgefordert, alles rauszugeben, was versteckt oder vergraben
war. Sie wollten das Gehöft anstecken und meine Frau erschießen.
In ihrer Angst zeigte sie ihnen alles. Nun holten sie alles hervor.
Nahmen mit, was ihnen gefiel und gingen ab. Jetzt rief mich meine Frau
vom Heuboden und sagte: "Gehe schnell zu Malottkis (2 km), die sind
katholisch, da kommen sie nicht." Ich eilte dort hin. Mit seinen
Kindern versteckten wir uns auf dem Heuboden. Die Leiter wurde
fortgenommen. Meine Frau blieb zu Hause. Um Mitternacht kommt Herr und
Frau Kolberg nach meinem Gehöft und bittet meine Frau, doch
aufzumachen. "Bei Nachbar Jantz ist schon was los. Alles Tote. Fritz
Jantz hat sich am Boden erhängt. Seine Frau und Tochter haben sich ins
Wasser gestürzt. Wir sind erschöpft." Herr und Frau Holz kamen aus
Furcht mir sofort nach. Meine Frau blieb noch da. Aus Verzweiflung ging
sie ebenfalls nach dem Fluß, um ihrem Leben ein Ende zu machen. Als sie
in den Fluten des kleinen Flusses den Tod nicht finden konnte, kroch
sie fast erstarrt mit der letzten Kraft noch aus dem eisigem Element
heraus. Erholte sich ein wenig. Ohne Schuh und mit letzter Kraft raffte
sie sich auf und kam gänzlich naß und erfroren zu Malottkis hin, wo ich
auch war. Sie nahmen sich ihrer an. Betteten sie warm ein und bald war
sie wieder auf den Beinen. Erst man frühen Morgen erzählte Malottki
mir, was geschehen war.
2 Tage blieben wir dort. Russen kamen, Russen gingen. Malottki war
katholisch und konnte polnisch sprechen. Sie taten ihm nichts. Am 3.
Tage, während die Russen da waren, kam auch Familie Kautz uns nach.
Auch Kautz war in Todesgefahr. Wir gingen mit seiner Familie zu dem
nächsten Gehöft, Rudnick, wo niemand mehr auf dem Hofe war. Auf dem
Heuboden hielten sie sich versteckt, sobald Russen sich näherten.
Verpflegt wurden sie von Malottkis aus. Jedes Haus wurde von den Russen
durchwühlt. Alles aus den Schränken rausgeholt. Möbel umgeworfen. Türen
waren durch umgeworfene Möbel versperrt. Nach 3 Tagen ging ich nach
meinem Hof zurück. Was mußte ich erblicken: Sämtliche 9 Kühe, Sterken
und Kälber waren fort. Pferde hatten sie ja gleich mitgenommen. Nur das
Fohl stand noch da. Unsere Oma, Herr und Frau Kolberg waren noch da.
Sie hatten alles ansehen müssen, wie sie das Vieh abtrieben.
In dem Zimmer war auch vieles umgeworfen, so daß ich von der
Küchentür nicht in die Wohnstube rein konnte. Es fehlte meine Brille,
die ich sonst täglich brauchte. So manches war verschwunden oder
beschädigt oder zerbrochen. Ich blieb nun zu Hause. Meine Frau kam auch
bald. Wir richteten alles wieder auf. Russen kamen immer wieder, doch
waren sie nicht mehr so gefährlich. Sie durchwühlten mit Vorliebe die
Betten, so daß wir sie schon nicht mehr fertig machten. Was ihnen
gefiel, wurde mitgenommen. Von den 100 Hühnern behielten wir nur 6.
Enten, Gänse und Puten waren schon längst weg. Sämtliches Korn und Heu
wurde abgeholt. Auf einzelnen Gehöften war noch das Vieh. Es brüllte;
denn es konnte nicht gefüttert noch gemolken werden. Ja, in manchen
Fällen waren die Tiere schon krepiert. Anderes Vieh lief im Schnee
herrenlos umher. Ich holte mir gleich 2 gute Kühe in den Stall, doch
der Russe kam immer wieder und nahm alles mit. Nochmals holte ich mir
eine gute Kuh, die sie mir dann nicht mehr nahmen. Am Bienenstand gab
es immer zu tun. "Honig, Honig oder sonst kaput!" Ich mußte mitten im
Winter den Bienenhonig entnehmen.
So dauerte der Russenbesuch vom 6. 3. bis 24. 4. 1945. Nach dieser
Zeit mußte so manches Unheilvolle wieder gut gemacht werden. 14 Tage
nach der Flucht kehrten die ersten Flüchtlinge meistens bettelarm
zurück. Nur wenige hatten das Glück, mit Pferd und Wagen
zurückzukommen. Mein Schwager Kramp kam zuerst mit seiner Familie auf
meinen Hof. Trotzdem alles verloren, freuten wir uns doch, daß sie nun
da waren. Die Familie Kowalke kam später. Die Mutter wurde auf der
Flucht erschossen. Nach und nach kamen auch die anderen. Doch die
Hälfte kehrte nicht zurück.
Es wurde allmählich ruhiger. Nun galt es, die gefallenen Soldaten
(etwa 20) von Freund und Feind zu beerdigen, die verendeten Tiere
ebenfalls vergraben. Eingebrochene Tiere mußten ebenfalls teils
lebendig, teils tot aus dem durchgebrochenen Keller rausgehoben werden.
4 große Brücken waren gesprengt; darunter 2 Bahnbrücken. Sie mußten
wieder hergestellt werden.
Die Eisenbahnschienen zwischen den beiden Kreisstädten
Rummelsburg-Bütow, 30 km, wurden aufgenommen. Überall mußten
arbeitsfähige Männer und Frauen den Russen bei der Arbeit helfen.
Mädchen und Frauen wurden immer wieder vergewaltigt.
Inzwischen hatte ich auch im Fluß die Leichen meiner Nachbarn
gefunden. Beide hatten sich zusammen gebunden und sich in den Fluß
gestürzt. Ich zog sie mit Lehrer Brüchzig heraus und am selben Tage
wurden sie auf ihrem Acker begraben. So wie mein Nachbar sind viele
Bürger aus Furcht vor den Russen freiwillig durch Erschießen, Aufhängen
oder Vergiften in den Tod gegangen. Andere wurden von den Russen
rücksichtslos erschossen oder verschleppt. Noch heute weiß ich nicht,
wo meine 5 Geschwister, die alle eine Besitzung im Kreise Bütow hatten,
geblieben sind. Meinen ältesten Bruder, 67 Jahre, hatten die Russen
auch mitgenommen. Doch er hatte sich beim Abrücken versteckt und so
entkam er ihnen. Mein jüngster Bruder ist zuletzt in Graudenz gesehen
worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. So sah es aus, als die Russen
kamen.
Nach und nach zogen die Russen allmählich ab. Nur ihre Kommandantur
blieb in Großtuchen bestehen. Ende April übernahmen die Polen die
Verwaltung. Ein Grundstück nach dem anderen wurde von den Polen
besetzt. Deutsche waren nur noch ihre Arbeitssklaven ohne Schutz und
Recht. Bis zum 20. Juli 45 war ich noch Besitzer meines Grundstückes.
Polen kamen, Polen gingen. Sie suchten sich die besten Grundstücke aus.
Es war der 21. 4. 45 *) um Mitternacht, als plötzlich an meiner
Haustür gerüttelt wurde. "Herauskommen", brüllten sie. Schnell zog ich
mich mit meinem Schwager Lehrer Schlösser an und wir gingen hinaus. Mit
vorgehaltenen Gewehren mußten wir Hände hoch halten. Man führte uns
hinter das Stallgebäude. Hier glaubten wir, daß unsere letzte Stunde
geschlagen hatte. Doch nein. Zuerst schrien sie: "Wo Kanne, wo Honig?"
Wir besorgten uns Kannen und gaben ihnen den Honig.
*) Offensichtlicher Schreibfehler. Es müßte der 21.7.45 gewesen
sein. Im April, als der Krieg noch tobte, hatten die Polen noch keine
Befugnisse zur Verhaftung. Außerdem deuten die berichteten Ereignisse
(z.B. Erntearbeiten in Zerrin) auf Juli-August hin. Es dauerte nicht
lange, da zogen sie ab. In der nächsten Nacht rüttelte es wieder an der
Haustür. Wir mußten eiligst herauskommen. Diesmal waren es 9
Milizsoldaten, die uns ausräuchern sollten. Zunächst wurden sämtliche
Zimmer durchsucht. Draußen wurde ich von 3 Milizsoldaten ergriffen und
mit dem Gummiknüppel zu Boden geprügelt. Fast besinnungslos ließen sie
mich dann liegen und fielen nun über meinen Schwager her, den sie
weiter auf die Wiese schleppten. Dort hörte ich die Hiebe und das
herzzerreißende Schreien von ihm. Ich glaubte, daß sie ihn auf der
Stelle totschlagen wollten und bat den Moddrower Kommandanten, daß sie
ihn nicht mehr schlagen sollten. Seine Tochter, die ebenfalls bei mir
war, holte ihn auf den Hof, wo er zusammenbrach, sich aber bald
erholte.
Alles wurde nochmals durchgestöbert, das Fahrrad herausgefordert.
Und dann erklang eine Stimme: "Ihr seid verhaftet, mitkommen." Ich bat
darum, daß ich mir die Gummistiefel anziehen durfte, und dann ging´s
nach dem Dorf, wo wir alle je in einen besonderen Keller gesperrt
wurden. Es war früh gegen 4 Uhr morgens. Gegen 9 Uhr vormittags
erschien der polnische Kommandant. Ich wurde nach allem ausgefragt.
Alsdann führte er mich mit vorgehaltenem Revolver in einen Stall, wo er
mich erschießen wollte, wenn ich nicht bekennen würde, wo ich was
versteckt hatte. Ich sagte ihm alles. Darauf fuhren wir mit der Kutsche
nach meinem Hof. Schlösser mit seiner Tochter blieben eingesperrt. 5
Milizsoldaten folgten uns. Alles durchsucht. Kleider nahmen sie mit.
Eine Milchkanne mit Honig gab ich heraus. Meine Frau mußte ein gutes
Frühstück machen, und zurück ging es.
Bei der polnischen Kommandantur stiegen wir ab. Der Kommandant gab
noch einen zum Besten; darauf fragte er mich: "Du mußt noch Pistole
haben?". Dieses verneinte ich. Er gab der Miliz Befehl, mich in den
Keller zu sperren. Schuldlos war ich wieder drin. Am nächsten Morgen
stand die Kutsche vor der Kommandantur. Wir wurden aus dem Keller
geholt und in Bütow der polnischen Gestapo übergeben. Grund unserer
Verhaftung war uns unbekannt. Vermutlich, weil wir Deutsche waren, und
auf meinem Hof ein Pole ungestört alles in Empfang nehmen sollte. Die
Gestapo sperrte uns ebenfalls in den Keller. Diesmal waren wir beide
zusammen. Was mit der Tochter geschah, wußten wir nicht. Nach etwa
einer Stunde öffnete sich die Kellertür. Ich mußte herauskommen. Sie
führten mich in eine Folterkammer; warfen mich über die Bank; hielten
Beine und Kopf fest. Unbarmherzig schlugen sie mich mit ihrem
Gummiknüppel so sehr sie konnten. Warfen mich runter, hackten und
stießen mich, wo es eben traf. Ich hatte wohl die Besinnung fast
verloren. Ja, ich weiß noch, daß ich die Hosen runter ziehen mußte; ob
sie dann noch gehauen haben, weiß ich nicht mehr. Ich wurde nun wieder
in den Keller gebracht. Jetzt holten sie Lehrer Schlösser. Dasselbe
Schicksal mußte er erleben. Wie sie ihn aus dem Keller brachten, floß
das Blut in seine Stiefel. Er konnte den ersten Moment nicht reden. Als
er zur Besinnung kam, sagte er: "Jetzt häng ich mich auf." Ich riet ihn
davon ab. Es war ja auch kein Strang im Keller. Gegen Abend gab es
wieder im Keller, doch nicht mehr so gewaltig. Die nächsten 2 Tage gab
es auch noch, aber an Wucht ließ es nach. Blaue Brillen hatten wir nun
beide. Schmerzen in der Brust spürte ich noch 14 Tage später.
Essen bekamen wir täglich 3 mal. Morgens Kaffee und ein Stückchen
Brot so groß wie eine Faust für den ganzen Tag. Zu Mittag abgekochte
Kartoffeln ohne Salz und jeglichen Zusatz. Meist noch angebrannt. Beim
Essen konnte ich nun auch unseren Kreisbauernführer Heß, unseren
Gastwirt Deuble, Reddies u.a. sehen. Meist mit blauen Augen, bärtigen
Gesichtern, tief gesunken und abgemagert. Sprechen durften wir nicht
miteinander. In den nächsten 2 Tagen waren auch der Moddrower
Bürgermeister, sein Sohn, die Bauern Julius Kolberg und Skibbe
eingeliefert. Beide aus Tangen. Auch diese erlebten dasselbe Schicksal.
Nach 3 Tagen wurden wir zur Arbeit herangezogen. Meistens Möbel von
einem Haus ins andere tragen, aber immer "Tempo". Den Höhepunkt bildete
die Ausräumung der zusammengenagelten Bettgestelle im Wirtschaftsamt
Bütow. Nur ein kleiner Hammer stand uns zur Verfügung. In kürzester
Zeit mußten die großen Zimmer leer sein. Mit Gewalt brachen wir die
langen Bretter auseinander. Warfen sie durchs Fenster oder trugen sie
zur Treppe hinunter wie ein paar Tollwütige. An jeder Ecke standen
Milizsoldaten und hauten mit ihrem Gummiknüppel auf uns ein. Wer nicht
Bretter genug auf dem Buckel hatte, mußte die des anderen mitnehmen.
Erst gegen Abend wurden wir in unsere Keller zurück geführt. Noch
hatten wir weder Frühstück noch Mittagessen bekommen. Todmüde und
erschöpft bekamen wir erst abends unser Essen. Durch die Straßen mußten
wir meistens mit kräftiger Stimme singen: "Polen, Polen über alles" und
das Seemannslied "Denn wir fahren nach Deutschland" usw. Des Sonntags
mußte unser Gastwirt Deuble, der polnisch sprechen konnte, Freiübungen
mit uns machen, z.Bsp. Arme vorwärts streckt, Knie beugt usw.
Nachdem wir etwa 14 Tage in Bütow zugebracht hatten, wurden wir
nach Zerrin aufs Gut zur Erntearbeit hingebracht. Hier hörte die
Prügelei so ziemlich auf. Im Gutshaus waren wir mit 35 Personen
beiderlei Geschlechts in 2 Zimmer untergebracht. Für gutes Strohlager
auf der ganzen Fläche sorgten wir. Täglich gingen wir zur Arbeit aufs
Feld. Ein Koch und zwei Mann blieben für die Küche. Ich war nur 1 ½ Tag
auf dem Feld tätig. Durch anschwellende Beine und Geschwüre blieb ich
für die Küche zurück. Auch mein Leidensgefährte Julius Kolberg
erkrankte. Nun waren wir beide in der Küche beim Kartoffelschälen. Auch
unser Gastwirt Deuble, der schon fast ½ Jahr drin saß, war nur noch ein
Skelett. Kolberg sagte zu mir: "Hier kommen wir nicht mehr raus;
entweder wir werden krank oder sterben." 14 Tage später wurden Deuble,
Kreisbauernführer Heß sowie sein Bruder und ein Bütower Siedler nach
Bütow zurück berufen. Kolberg und ich fuhren als Kranke mit. Bei der
Landwirtschafts-schule machten wir Halt. Kolberg brach zusammen. 2 Tage
später war er tot. Wo die andern 4 blieben, weiß ich nicht. Ich landete
im Keller der Landwirtschaftsschule, wo noch mehrere drin waren. Man
ließ mich in Ruhe. 3 Tage später mitternachts, die Kellertür wird
geöffnet, wieder werden einige eingeliefert. Einer fragte: "Sind hier
auch Großtuchener drin?" Ich er-kannte an der Stimme unsern Müller
Reddies. Außerdem waren Haus und 4 Jugendliche aus Großtuchen dabei. Am
nächsten Tage lernten sie ebenfalls den Gummiknüppel kennen. Mit blauen
Augen kamen einige in die Zelle zurück.
Wieder vergingen 2 oder 3 Tage. Da wurde ein Russe, der in einem
Dorf Bürgermeister war, in unsern Keller geliefert. Der russische
Bezirkskommandant forderte von den Polen die sofortige Entlassung des
russischen Bürgermeisters. Beim Verlassen unseres Kellers soll er
gesagt haben: "Ich werde dafür sorgen, daß ihr auch entlassen werdet."
Es verging kaum ein Tag, als der polnische Kommandant in den Keller kam
und jeden einzelnen fragte, wie lange er schon eingesperrt sei und
weswegen. Wir mußten unsere Sachen aufnehmen und nach dem Büro kommen,
um unsere Entlassungskarten in Empfang zu nehmen. Hocherfreut hauten
wir ab. Nur die 4 Jungens blieben da, denn sie waren nicht im Keller.
Welch eine Fügung Gottes. Der Russe hat mich befreit. Im eiligen Tempo
gingen wir die Bahnstrecke entlang nach Hau-se. Meine Frau und Oma
empfingen mich mit Freudentränen.
Auch der Pole, der mein Grundstück in Besitz genommen hatte, war
freundlich. Schnitt mir sofort die Haare und rasierte mich. Nun sah ich
wieder wie ein Mensch aus. Ein gutes Essen wurde eingenommen; denn in
den fast 5 Wochen gab es so was nicht. Sofort habe ich mich gewaschen
und reine Wäsche und Kleider angezogen. Ich fühlte mich wie neugeboren,
trotzdem ich körperlich sehr runtergekommen war. Von meinen Kleidern
fand ich nicht viel.
Erstaunt war ich, wie ich sehen mußte, daß der Pole meine langen
Stiefel angezogen hatte und einen meiner Schlipse trug. Doch ich war
durch die harte Schule gegangen und ließ mir nichts merken; da ich
genau wußte, sobald ich ihm lästig wurde, brauchte er der Miliz nur
einen Wink zu geben, und sie holten mich wieder ab. Alles, was ich
seinen Augen ablesen konnte, habe ich gemacht, denn er war, wie er
sagte, ein großer Deutschenhasser. Essen durften wir bei ihm in der
Küche, doch in unsere Zimmer, in denen meine Frau alles drin lassen
mußte, durften wir nicht mehr kommen. Ein Zimmer mit Küche hatte er uns
gelassen. Täglich haben wir dann ohne jegliche Besoldung bei ihm
gearbeitet. Nur Essen bekamen wir. Es war ja noch immer von unserm. Die
Bienen mußte ich ihm weiter besorgen. Über 10 Ztr. Honig hatte ich
geerntet. Einen großen Teil hatten die Russen und Polen schon
weggeholt. Gemeinsam habe ich dann mit meiner Frau auf dem Feld
gearbeitet oder er schickte uns zu Gemeinschaftsarbeiten zu den
Nachbarn, die ihm dann wieder halfen. Die Kartoffeln, von denen ich
noch 5 Morgen ausgepflanzt hatte, pflügte er aus, ließ sie aufsammeln
und auf Haufen schütten, ohne sie zuzudecken. In einer einzigen Nacht
waren sie oben alle angefro-ren. Seine erste Prüfung hatte er dadurch
bereits bestanden.
So sah es mit seiner Bewirtschaftung aus. Das alles mußte man
ansehen, ohne etwas zu sagen. Im September 1945 waren fast alles
Grundstücke von den Polen besetzt. Die Männer festgenommen oder
eingesperrt. Mein Schwager O. Kramp, der von den Russen nach Grau-denz
mitgenommen wurde und dann wegen seiner Krankheit wieder zu Fuß den
Heimweg antreten durfte, wurde ebenfalls von den Polen über 5 Monate
festgehalten.
Nach der Ernte mußten wir unsere Auswanderung beantragen. Wer noch
dablieb, konnte binnen 2 Stunden rausgewiesen werden. Nachdem wir nun,
Familie Kramp, Kowalke unsere Auswanderungspapiere vom Landrat
zugestellt bekamen, durften wir am 16. 11. 1945 über die Oder
auswandern. Schwer war es uns allen, unser Haus und Hof, was unsere
Väter und Urgroßväter in bitterem Schweiß zusammengearbeitet hatten,
stehen zu lassen, und mit dem zu flüchten, was man nur bei sich tragen
konnte. Aber was half es alles. Noch einmal sahen wir alles an. Unsere
Oma, 82 Jahre, konnte wegen Altersschwäche nicht mit. Sie wollte
zu-rückbleiben. Der Pole machte auch weiter keine Einwendung. So
verließen wir am 16. 11. 45 mit weinenden Augen unseren Hof. Der Pole
hatte in diesem Augenblick ein wenig Mitleid und fuhr uns nach Bütow
zur Bahn. Hier versammelten wir uns mit Familie Kramp, Familie Kowalke,
Familie Trapp, Zemmen, und Familie Knopp, Bütow. Mit unsern
Habseligkeiten kamen wir gut durch die Sperre.
Um 7 Uhr setzte sich unser Zug in Bewegung. Eine Stunde später
waren wir in Lippusch angelangt. Erst um 2 Uhr früh ging der Zug weiter
nach Konitz. Mitternacht hat die Bahn-hofswache uns Männer einzeln mit
unserm Gepäck etwa 200 m weiter in einen Dienstraum abgeführt. Nach
unserer Parteizugehörigkeit ausgefragt. Ein Leugnen gab es nicht; denn
sie hatten dort einen Ostarbeiter, der lange Zeit in Großtuchen war und
uns zu gut kannte. Glücklicherweise gehörten wir keiner Partei an. Wir
mußten unsere wenigen Habseligkeiten ausschütten. Alles wurde einzeln
durchsucht.
Was ihnen gefiel, nahmen sie uns ab. Ich verlor dadurch eine
Haarschneidemaschine, Schere und andere Kleinigkeiten. Alles andere
raffte ich schnell wieder
zusammen in den Sack. So wurden die Männer alle vernommen.
Über Konitz - Schneidemühl ging es nach Küstrin. Mit vielen
Hindernissen kamen wir nach 17 stündiger Fahrt in Küstrin an. Hier
blieben wir 9 Tage im
Auffangslager. Kein Haus war mehr ganz. Jeder mußte sich da selbst eine
Unterkunft in den zerschossenen und ausgebrannten Häusern suchen. Mit 3
Familien (10
Personen) bezogen wir eine Küche, dazu noch all unsere Sachen drin. 2
namentliche Listen aufgestellt. Diese wurden dann der deutschen Polizei
nach langer Zeit
endlich zur Anmeldung eingereicht.
Mit der einen, die ich wieder zurückerhielt, konnten wir unser Essen
empfangen. Doch mußte man des Morgens früh um 6 Uhr für Brot und Mittag
anstehen, wenn
man was haben wollte. 25 - 30 000 Flüchtlinge waren im Lager. Wieder
machten die Polen ihre Geschäfte. Vielen Flüchtlingen gingen unterwegs
ihre Habseligkeiten
verloren und sie hatten nichts mehr zu essen. Sie zahlten meistens 120
Mk für ein 3-Pfd.-Brot. Selbst meine Frau hat ein solches Brot für den
Preis gekauft. So sah
die polnische Verwaltung östlich der Oder aus. Am 26. 11. 45 setzte
sich der 2. Transportzug aus Küstrin langsam über die notdürftig
hergestellte Oderbrücke in
Bewegung. Aus den einzelnen Abteilen hörte man das Lied singen "Nun
ade, du mein lieb´ Heimatland".
Fast eine Woche lang lagen wir auf der Bahn, bis wir endlich auf
unserm Ziel Feldberg, Kreis Stargard, Mecklenburg, ankamen. In Feldberg
standen Wagen zur
Abholung bereit. Mit 130 Personen kamen wir in das Gutsdorf Schlicht, 4
km von Feldberg.
In einem großen Kuhstall wurden wir alle untergebracht. Noch lag zum
großen Teil der alte Dung drin. Ein jeder holte sich ein Teil Stroh und
machte sich sein Lager.
Durch das Dach konnte man abends die Sterne sehen; es war kalt. Der
Bürgermeister hatte für warme Kartoffelsuppe gesorgt. Auch Brot
gelangte zur Verteilung. In
den nächsten Tagen bezogen wir mit 11 Personen ein Gutszimmer. Die
ersten Tage hatten wir Gemeinschaftsverpflegung, dann bekam jeder seine
Lebensmittelkarten, für die es wenig gab. Wo nun kochen? Schnell
mauerte ich einen Kochherd mit 2 Kochlöchern. Doch es waren 3 Familien;
dazu Aschendorf als
Einzelgänger. Noch mußte ich einen Herd anbauen. Nun ging´s schon. Noch
sorgte der Bürgermeister für Brot und Kartoffeln. Männer gingen meist
zur Arbeit. Erst
im Wald bei den Russen Holz verladen. 8 Tage lang vor dem
Weihnachtsfest nachts pflügen. Na, das sah schon aus!
Zuletzt mußten Männer und Frauen ein abmontiertes Schotterwerk
verladen. Aschendorf zog sich dabei eine innere Verletzung zu und
starb. Weihnachten feierten
wir noch beisammen ganz schlicht in "Schlicht".
Viele der Flüchtlinge verließen bald das Gutsdorf. Auch wir konnten
dort nicht bleiben. Am 28. 1. 46 fuhr ein Transportzug nach
Heiligenstadt bei Kassel, Endstation
der russischen Zone. Hier mußten wir teils zu Fuß, teils mit Handwagen
über die russisch-englische Zonengrenze, um nach dem Flüchtlingslager
Friedland zu
gelangen. Hier wurden wir untersucht, entlaust und registriert. Noch
lag unser Ziel nicht fest. Viele Transporte gingen nach Schleswig, doch
wir entschlossen uns für
Haddamar, wo unsere Schwägerin Emmy Kowalke auch war.
Die nötigen Papiere zur Grenzüberschreitung mußten aus Göttingen
beschafft werden. Und so fuhren wir mit all unserem Gepäck nach Kassel
über Eichberg. Hier in
Eichberg mußte alles aussteigen. Die Papiere wurden von den Amerikanern
geprüft. Kramps und Kowalkes Papiere wurden für richtig befunden, und
sie durften
weiter fahren; dagegen mußten meine Frau und ich mit denselben Papieren
nach Göttingen zurück. Erst nachdem ich unter den schwierigsten
Verhältnissen keine
anderen Papiere bekam, ließ man uns am Abend nach Kassel fahren und wir
kamen dann nach Wabern, wo wir auf dem Bahnhof übernachteten. Mit dem
ersten
Zuge am 2. 2. 1946 gelangten wir am Bahnhof Fritzlar an. Wir warteten,
denn es war noch dunkel. Unser Gepäck wurde zur Aufbewahrung
aufgegeben. Und so
gingen meine Frau und ich zu Fuß nach Haddamar. Bei Tante Emma, Frau
Kowalke, angelangt, wurde ein wenig geruht. Erlebnisse erzählt. Nun der
Weg zum
Bürgermeister, der uns eine Wohnung bei Herrn Feitz zuwies; doch da wir
in der kleinen Wirtschaft keine Beschäftigung hatten, gingen wir ein
Haus weiter, wo wir
Frau Steinmetz vor dem Kuhstall trafen.
Wir bekamen da Wohnung und blieben da. 2 Monate hatten wir hier
Arbeit und Brot. Erst als ihr Bruder kam, hatten wir wenig
Beschäftigung. Wir richteten dann
(uns) selber unsere Küche ein. Und ich fand dauernde Beschäftigung bei
dem Bauern Wilhelm Meijt. Familie Kramp fand beim Bauern Arndt
Unterkunft, Arbeit und
Brot. Die Kinder Kowalkes blieben bei ihrer Tante Emmy Kramp. Später
kam auch ihr Vater.
Meine 2 Söhne Helmut und Heinz waren in amerikanischer
Gefangenschaft. Heute sind auch sie bei mir. Ihre Beschäftigung fanden
sie im Verpflegungsamt Fritzlar
bei den Amerikanern.
Während wir bis hier nur Schrecken des Krieges kennengelernt hatten,
fanden wir hier noch alles wie im Frieden vor. Keine Furcht mehr vor
Russen und Polen,
denn es sind ja Amerikaner. Alles unversehrt. Sämtliches totes und
lebendes Inventar ist hier. Felder waren friedensmäßig bestellt. Aus
allen Häusern strahlt
elektrisches Licht entgegen. Ja, hier ist noch kein Krieg gewesen. Land
und Leute haben wir hier kennengelernt. Neue Bürger sind wir hier
geworden. Der
Bürgermeister setzt sich für das Wohl seiner Neubürger ein. Eine wahre
Heimat haben wir hier noch nicht. Die Gründe hierfür müssen wir uns
noch vorenthalten.
Wahre Heimat ist einzig und allein unsere Kirche, wo der Name Jesus
Christus gepredigt wird.
Diese eigenen Erlebnisse habe ich nach bestem Wissen und Gewissen
für mich und meine Kinder und für diejenigen, die es wissen wollen, in
diesem Büchlein
niedergeschrieben. Dies ist nur ein Einzelfall von den fast 10
Millionen Flüchtlingen, die ihre Heimat, Haus und Hof verlassen mußten.
Unser einzigster Wunsch und heißes Gebet zu Weihnachten ist: Gebt
uns bei der bevorstehenden Friedenskonferenz unsere alte Heimat wieder.
Schickt die
Gefangenen heim!
Haddamar, Weihnachten 1946 P. Biastoch
Nachbemerkung zur polnischen Verwaltung:
In den ersten Tagen, als mein Schwager, der Lehrer Schlösser, und
ich von der polnischen Miliz der polnischen Gestapo überliefert wurden,
wurden wir beide in die
Folterkammer geführt. Mein Schwager mußte sich über die Bank legen,
während ich ihm 20 Hiebe mit dem Gummiknüppel aufzählen mußte. Als ich
ihm 17 Hiebe
gehauen hatte, entriß man mir den Gummiknüppel. Und sie zählten ihm
wohl 1 Dutzend Hiebe auf, so wie sie sitzen sollten. Auch ich bekam
eine Kostprobe davon.
Später zeigte man mir ein Paßbild. Sie fragten mich, ob ich es sei. Ich
antwortete: "Ich bin es nicht." Ein Wink, und ich mußte in die
Folterkammer. 20 Hiebe zogen
sie mir über. Dann fragten sie mich: "Bist du´s?" Trotzdem ich es nicht
war, sagte ich: "Es ist mein Bild." Dann schlugen sie mich nicht mehr.
Wer mit gutem Anzug oder Stiefeln der polnischen Gestapo
eingeliefert wurde, dem zogen sie die Kleider und Stiefel aus und gaben
ihm zerlumpte und zerrissene
Kleider und Schuhe. So ging es unserem Gastwirt Deuble, meinem Schwager
Schlösser u.a. Auch ich ging mit einem Stiefel und einer Holzlatsche.
Flicken konnten
wir uns so was nicht; denn wir hatten weder Flicken noch Nadel und
Zwirn. Schlafen mußten wir auf dem Zementboden. Pritschen kannte man
dort nicht. Von den
Läusen wurden wir übel geplagt. Wäsche konnten wir nicht waschen. Wir
hatten ja auch nur ein Hemd¸ das wir anhatten. Immer wieder wurde uns
gesagt: "Wir
geben es den Deutschen nur zu 50 % ab, was sie an uns getan haben." So
mußten wir als Deutsche unschuldig leiden. Mein Leidensgefährte Kolberg
starb schon
nach 4 Wochen; Gastwirt Deuble später. Lehrer Schlösser wurde halb tot
entlassen. Reddies Wilhelm holten sie zum 2ten mal. Beim Abschied sagte
er: "Ich muß für
euch sterben." Alle aus Großtuchen. So ging es vielen anderen. Auch mir
wäre es so ergangen, wenn ich nicht, wie ich eingangs erwähnt habe,
durch den russischen
Bürgermeister wie durch ein Wunder nach fast 5 Wochen Haft entlassen
worden wäre.
Recht verstehen und empfinden kann nur derjenige es, der solches und
ähnliches miterleben mußte, und diese Zahl geht in die Hunderttausende.
Haddamar, den 1. März 1947 P.B. [Paul Biastoch]
o o o
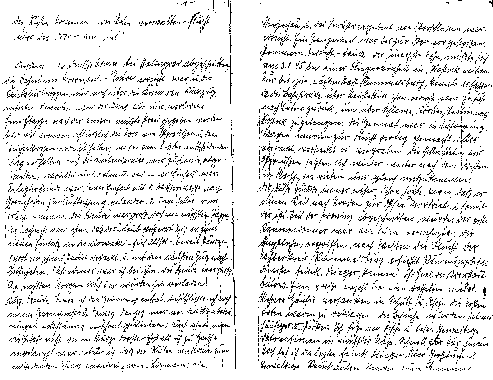 Seitdem die 6. deutsche Armee bei Stalingrad abgeschnitten, die
Bahnlinie Woronesch - Rostow erreicht war, und die Kaukasustruppen nur
noch über die Krim den Rückzug antreten konnten, war der Krieg für uns
verloren. Eine Etappe nach der anderen mußte preisgegeben werden, bis
die russischen Armeen schließlich die Tore von Ostpreußen und den
Weichselbogen erreicht hatten; wo sie zum letzten entscheidenden Schlag
ausholten. Auch die Kurlandarmee war zu Lande abgeschnitten; woselbst
unser Helmut bei einer Einheit war. In letzter Stunde war seine Einheit
auf dem Wasserwege nach Gotenhafen zur Auffrischung gelandet. 2 Tage
sollte er in Urlaub kommen. Die Freude war groß. Doch am nächsten Tage
die Nachricht von ihm, daß der Urlaub gesperrt sei und sie zum neuen
Einsatz in die Slowakei - Ziel Altfol - bereit ständen. Sofort ein
schönes Paket gepackt und mit dem nächsten Zug nach Gotenhafen. 5 Uhr
abends war ich bei ihm. Die Freude war groß. Am nächsten Morgen früh 5
Uhr wurden sie verladen. Kurze Freude. Bevor ich den Heimweg antrat,
besichtigte ich noch meine Garnisonstadt Danzig. Danzig war von den
Bombardierungen vollständig verschont geblieben; auch ahnte man die
Gefahr nicht, die in Kürze drohte. Erst als ich zu Hause angelangt war,
erfuhr ich, daß die Russen wiederum zum entscheidenden Schlag angesetzt
hatten. Litzmannstadt, Tschenstochau und das Industriegebiet von
Oberschlesien war erreicht. Ein Panzerkeil war bis zur Oder
vorgestoßen. Pommern bedroht.
Seitdem die 6. deutsche Armee bei Stalingrad abgeschnitten, die
Bahnlinie Woronesch - Rostow erreicht war, und die Kaukasustruppen nur
noch über die Krim den Rückzug antreten konnten, war der Krieg für uns
verloren. Eine Etappe nach der anderen mußte preisgegeben werden, bis
die russischen Armeen schließlich die Tore von Ostpreußen und den
Weichselbogen erreicht hatten; wo sie zum letzten entscheidenden Schlag
ausholten. Auch die Kurlandarmee war zu Lande abgeschnitten; woselbst
unser Helmut bei einer Einheit war. In letzter Stunde war seine Einheit
auf dem Wasserwege nach Gotenhafen zur Auffrischung gelandet. 2 Tage
sollte er in Urlaub kommen. Die Freude war groß. Doch am nächsten Tage
die Nachricht von ihm, daß der Urlaub gesperrt sei und sie zum neuen
Einsatz in die Slowakei - Ziel Altfol - bereit ständen. Sofort ein
schönes Paket gepackt und mit dem nächsten Zug nach Gotenhafen. 5 Uhr
abends war ich bei ihm. Die Freude war groß. Am nächsten Morgen früh 5
Uhr wurden sie verladen. Kurze Freude. Bevor ich den Heimweg antrat,
besichtigte ich noch meine Garnisonstadt Danzig. Danzig war von den
Bombardierungen vollständig verschont geblieben; auch ahnte man die
Gefahr nicht, die in Kürze drohte. Erst als ich zu Hause angelangt war,
erfuhr ich, daß die Russen wiederum zum entscheidenden Schlag angesetzt
hatten. Litzmannstadt, Tschenstochau und das Industriegebiet von
Oberschlesien war erreicht. Ein Panzerkeil war bis zur Oder
vorgestoßen. Pommern bedroht.